
Wir erzählen – Gedanken zu unserem Handwerk
Wir erzählen … immer
Der Mensch ist das Geschichten erzählende Tier, sagte Roland Barthes, Philosoph und Erzähltheoretiker, einmal sinngemäß. Nun haben schon viele versucht, zu definieren, was uns von allen anderen Tieren unterscheidet – Sprache, Empathie, das Töten der eigenen Spezies, der aufrechte Gang – und leider funktioniert das meist nicht so gut. Es ist immer einfacher, zu definieren, was der Mensch ist, als das, was andere Tiere nicht sind.
Sei dem, wie es wolle: Geschichten zu erzählen, scheint eine universelle Konstante zu sein. Der Mensch erzählt Geschichten: um seine Welt zu interpretieren, um sich anderen mitzuteilen, um Wissen weiterzugeben, um sich zu erinnern, um sich selbst zu verstehen, aber auch, um sich selbst darzustellen.
Was ist erzählen?
„Heute hatte ich Müsli zum Frühstück. Sonst esse ich immer Eier, aber diesmal dachte ich: ‚Warum nicht?‘ Es war scheußlich!“ – Schon das ist eine Erzählung. Vielleicht nicht besonders spannend, aber die grundlegendsten Geschichten funktionieren alle so. Und wenn wir mal ehrlich sind: Uns selbst, dem Erzähler und „Helden“ dieser Story, interessiert es durchaus, ob unser Frühstück scheußlich war oder nicht.
Das Verstehen von Erzählungen ist genauso universal wie das Erzählen selbst, ja, vielleicht noch mehr. Nicht jeder kann eine Geschichte erzählen, die auch andere interessiert, während ein talentierter Erzähler selbst die Story vom Müsli spannend gestalten kann.
Nicht jeder kann gut erzählen. Aber fast alle wissen wir, wann eine Geschichte flach fällt, nicht spannend ist, und wann sie uns mitreißt – verschiedene Geschmäcker mal nicht eingerechnet. Wir sind in unserer Kultur umgeben von Geschichten. Egal ob Bücher, Filme, Werbespots oder Großmütter – alle erzählen uns ständig Geschichten.

Und darum lernen wir von klein auf, wie Erzählungen funktionieren: Sie haben einen Anfang, eine Mitte (einen Höhepunkt) und ein Ende, und es geht darin um mindestens einen Menschen, dem etwas passiert. In der Regel entspannt sich ein Konflikt zwischen dem Menschen und seiner Umwelt oder anderen Menschen, und die Geschichte ist dann zu Ende, wenn sich der Konflikt auflöst – ob zum Guten oder Schlechten. Die Auflösung des Konflikts verschafft uns als Leser eine gewisse „Entspannung“, egal, ob wir uns mit dem Helden freuen oder mit ihm leiden. Sie entlässt uns wieder in die Welt jenseits der Geschichte.
Wie erzählen wir?
Diese Grundstruktur versteht jeder. Und es kann sie auch jeder bauen. Die Frage ist nur, wie gut. Letzteres ist eine Frage der Erzähltechnik. Erzähl-Coach Otto Kruse beschreibt diese „als die grundlegenden sprachlichen Mittel, die man einsetzen muss, um Erzählfiguren handeln, denken und fühlen zu lassen.“
Hier trifft Kruse gleich den Nagel auf den Kopf: In einer Erzählung geht es um ein Geschehen. Aber zu diesem Geschehen kommt es nur, weil es „handelnde Figuren“ gibt, die es erleben, davon durchgeschüttelt werden, es durchleiden müssen. Und wir erfahren nur etwas darüber, weil es eine „erzählende Figur“ gibt, die uns darüber berichtet. Eine Erzählung besteht also aus drei grundlegenden Elementen:
- Die Handlung (der plot)
- Die handelnden Charaktere, oft eingeteilt in Protagonisten (Helden) und Antagonisten (Gegner)
- Die Erzählstimme
Grundideen einer Erzählung
Es gibt viele Autoren, die sich erst ihr Handlungsgerüst zusammenzimmern, bevor sie zu schreiben anfangen. Und tatsächlich beginnt jeder Schreibprozess in der Regel mit einer Handlungsidee: „Was, wenn sich ein junger Mann und ein Mädchen aus zwei verfeindeten Familien unsterblich ineinander verlieben?“
Das ist die Grundidee für eine Geschichte. Sie enthält schon die wichtigsten Charaktere als auch den Kern für eine Handlung, oder zumindest den Ausgangspunkt. Auch der Grundkonflikt ist schon angelegt.
Natürlich kann es auch passieren, dass man erst einmal einfach eine Situation im Kopf hat oder auch nur ein einzelnes Bild, von dem ausgehend man einfach zu schreiben anfängt. Aber meistens beginnt man von selbst, auf ein Ziel hin zu erzählen (ob dies das „richtige“ Ziel für die Erzählung ist, sei einmal dahingestellt). Andernfalls ist das Ganze ein sehr experimenteller Schreibprozess, der natürlich auch sehr spannend sein kann!
Doch wir sind momentan ja beim traditionellen Erzählen. Es ist die Grundlage jeder Literatur. Wir teilen Texte zwar in berichtende, dramatische, lyrische und erzählende Texte ein, aber in Wahrheit erzählt auch ein Drama, ein Zeitungsartikel oder sogar ein Gedicht. Es gibt Spielarten, die sich weiter vom Ursprung weg bewegen, die zum Beispiel kein richtiges Ende mehr kennen oder sich viel mehr auf die Sprache konzentrieren als auf das, was damit gesagt wird. Oder die Texte sind so verschlüsselt, dass die Geschichte, die erzählt wird, nur noch schwer erkennbar ist. Aber alles hat irgendwann mal als Erzählung angefangen.
Die Textgattung, die sich am leichtesten vom Erzählen loslösen lässt, ist das Gedicht, denn es ist auch mit einer anderen Kunstform verwandt: dem Lied. Bei einem Gedicht geht es darum, mit Sprache Atmosphäre, Gedanken und/oder Gefühle zu transportieren. Das kann mit der Form der Erzählung geschehen, wie etwa bei einer Ode, muss aber nicht.
Die Sache mit der Übung
Zum Erzählen gehört viel Übung. Wem es schwerfällt, einen Spannungsbogen zu konstruieren oder lebendige Figuren zu entwerfen, sollte erst einmal damit anfangen, viel zu lesen und/oder viele Filme anzusehen und sich dabei überlegen: Wie geht der Autor/der Filmemacher hier vor? Warum finde ich die Geschichte so spannend? Wie ist das Ganze aufgebaut? Mit welchen Figurentypen, welcher „Besetzung“ wird gearbeitet?
Nicht jede*r muss so systematisch vorgehen. Oft haben wir schon so viele Erzählungen „intus“, dass wir solche Dinge ganz instinktiv machen. Aber wer Probleme hat, eine Erzählung zu entwerfen, kann ruhig einmal etwas methodischer an die Sache herangehen. Und dann gilt es: selbst ausprobieren!
Um das „Stricken“ eines plots in den Griff zu bekommen, muss man nicht immer schreiben. Es macht auch durchaus Spaß, Ideen erst einmal mit Notizzetteln und Karteikarten von Anfang bis Ende zu entwickeln, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie Geschichten funktionieren. Nicht jede dieser Storys wird es wert sein, aufgeschrieben zu werden, aber es ist eine gute Übung!
Organisches Wachsen
Andere finden es einfacher, von einer Grundidee aus loszuschreiben, ohne ein gewisses Ziel zu haben, und die Geschichte organisch wachsen zu lassen. Diese Methode ist genauso legitim; es handelt sich lediglich um unterschiedliche Schreibtypen.
Solche Autoren lassen sich gerne von den zwei anderen Elementen tragen, die zu einer Erzählung dazugehören: den Charakteren und dem Erzähler. Wenn ich meine Charaktere schon gut kenne und/oder sie in einen interessanten Grundkonflikt zusammenbringe, dann passieren beim Schreiben oft Dinge, an die man beim Plotten nie gedacht hätte. Jede*r Schreibende muss selbst herausfinden, welche Art von Autor er oder sie ist – instinktiv oder methodisch oder ein Mischwesen!
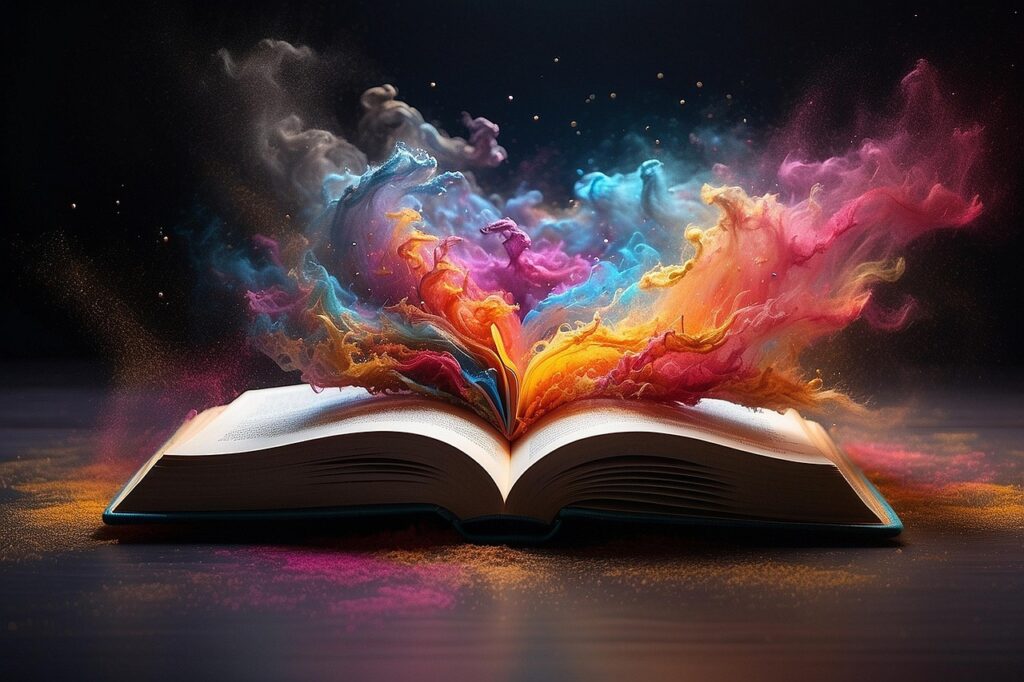
Handlung, Charakter, Erzähler
Wir haben die drei Elemente, die zu jeder Erzählung gehören, nun schon mehrmals angesprochen: Handlung, Charaktere, Erzähler. Ich brauche ein Geschehen, jemanden, der es erlebt, und jemanden, der es mir erzählt.
Diese drei Elemente werden aber nicht einzeln entwickelt. Schon am Romeo-und-Julia-Beispiel zeigt sich, dass mindestens zwei dieser drei Elemente immer zusammenspielen: ohne die handelnden Figuren kann das Geschehen sich nicht entfalten, und ohne ein Geschehen (und sei es nur ein „inneres“) bleiben die Figuren stehen.
Man könnte sagen, das vierte notwendige Element der Erzählung ist die Verknüpfung aller Elemente. Kruse formuliert es so: „Man lernt nicht nur, Dinge, Personen, Ereignisse, Zeitpunkte und Orte zu benennen, sondern die Textsorte Erzählung zwingt einen dazu, diese Elemente miteinander in Beziehung zu setzen und so zeitlich oder kausal miteinander zu verknüpfen.“
Erzählen ist verknüpfen
„Das ist im Endeffekt das Geheimnis, das hinter jedem plot steht: B geschieht, weil vorher A geschehen ist, und weil B geschehen ist, wir später C eintreten.“ – So Kruse.
Geschehnisse folgen auseinander und Charaktere reagieren auf Handlungen und Ereignisse. All das sind sogenannte „Plot-Punkte“, die nicht einfach nebeneinander stehen oder nacheinander folgen, sondern logisch und konsequent miteinander verknüpft sind. Nimmt man einen plotpoint heraus, dann bricht das ganze Gerüst zusammen – oder zumindest ein großer Teil davon.
Auch die Gegenprobe funktioniert: Wenn man (versuchsweise) einen plotpoint herausnimmt und sich nichts an der Geschichte ändert, sollte man sich überlegen, warum er überhaupt da ist. Überflüssige plotpoints stören oft beim Lesen, aber auch beim Schreiben und können sogar die Kreativität blockieren, weil man sich unnötig darauf konzentriert.
Ein anderer Trick bei einer Erzählblockade besteht darin, versuchsweise einen plotpoint aus der Geschichte herauszunehmen, den man für essentiell wichtig hält. Vielleicht ist es sogar der erste Gedanke, die Idee, wegen der man die Geschichte überhaupt erzählen wollte. Aber Geschichten entwickeln sich, und manchmal blockieren alte Ideen, die einst wichtig waren, den kreativen Fluss. Eliminiert man diesen festgefahrenen plotpoint, kann sich die Geschichte möglicherweise in neue Richtungen entwickeln.
Regeln fürs Erzählen?
Festgeschriebene Regeln fürs Erzählen gibt es nicht. Jede Regel, die irgendwann einmal aufgestellt wurde, kann gebrochen werden – und so ein Regelbruch kann großen Unfug, aber auch geniale Texte nach sich ziehen. Auf jede Person, die sagt „dies und das darf man nicht machen“, kommen zehn, die es mit großem Erfolg doch gemacht haben – und wahrscheinlich tausende, die nicht auf die erste Person gehört und nur Misserfolg geerntet haben.
Was es gibt, sind Modelle, wie Texte gut funktionieren, und Methoden, wie man Erzählungen erfolgreich schreibt. Wer diese Taktiken und Wegweiser kennt, hat vermutlich größere Chancen, eine ordentliche oder auch sehr gute Erzählung zustande zu bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass jemand, der alle Richtlinien in den Wind schießt, nicht auch einen hervorragenden Text schreiben könnte.
Es ist aber einfacher, die Regeln zu brechen, wenn man sie kennt. Kruse formuliert es folgendermaßen: „Erstens: Autoren müssen sich mit modernen Erzählformen und deren ästhetischen Gesetzen auseinandersetzen, denn in diesem Feld müssen sie sich behaupten. Und zweitens: Autoren müssen lernen, dass sie sich nicht darum scheren dürfen, was moderne Erzählformen sind und welche Gesetze dort herrschen. Sie müssen stattdessen ihre eigene Erzählstimme und ihre eigene Ausdrucksweise finden.“
Und dann ist da noch die Sprache
Damit sind wir nun endlich beim fünften und letzten Element angelangt, das jede Erzählung braucht. Es ist das einfachste und doch das schwerste: die Sprache.
Geschehen und Charaktere bestimmen, was ich erzähle. Der Erzähler ist derjenige, der erzählt. Aber die Sprache ist das, was erzählt, und gleichzeitig das, wie erzählt wird. Ohne Sprache, die meine Ideen in Worte fasst, gibt es natürlich gar keine Erzählung. Ich kann mir noch so viele schöne Situationen und Figuren ausdenken – es hilft mir nichts, wenn ich sie nicht in Worte fassen kann.
Geschehen und Figuren sind besonders eng verknüpft, Erzähler und Sprache stehen in einem ähnlich engen Zusammenhang. Der Erzähler ist die Stimme, die die Sprache ausspricht. Die Art der Sprache bestimmt die Art der Erzählung und charakterisiert den Erzähler.
Mit den richtigen Worten erzählen
Wie fasse ich etwas in die richtigen Worte? Auch dabei helfen zwei Dinge: viel lesen und viel schreiben. Zu sehen, wie andere etwas in Worte fassen, kann dabei helfen, den eigenen Stil zu finden.
Manchmal geht das Schreiben und Worte-Finden ganz problemlos – oft ist es aber auch harte Arbeit. Man sollte sich davon nicht entmutigen lassen, wenn einem nicht gleich die richtigen Worte einfallen. Schreiben ist nicht immer Musenkuss; selbst oder gerade die besten Autoren verzweifeln oft an einem einzigen Satz.
Warum kann das so anstrengend sein? Kruse erklärt es folgendermaßen: „Wenn man Texte herstellt, ist man ständig gezwungen, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Mit jedem neuen Wort legt man den Verlauf der Geschichte weiter fest, mit jedem neuen Satz definiert man sich als Autor genauer. Diese Entscheidungen sind es, die das Schreiben so anstrengend machen.“
Aber auch das Gegenteil ist der Fall: einfach drauflos schreiben oder auch bis zum Umfallen an einem Wort, an einer Formulieren feilen, macht Spaß und ist befreiend. Und auch hier gilt: Übung macht den Meister.
Zusammengefasst
Jede Erzählung besteht aus fünf Elementen:
- Die Handlung (das, was geschieht)
- Die Charaktere (die Figuren, die handeln)
- Die Verknüpfung von Charakter- und Handlungselementen (wie hängen sie zeitlich und kausal zusammen)
- Der Erzähler (die Figur/Stimme, die erzählt)
- Die Sprache (das „Wie“ des Erzählens)
Die besten Erzählungen entstehen, wenn alle fünf Ebenen gut miteinander harmonieren und aufeinander abgestimmt sind.
